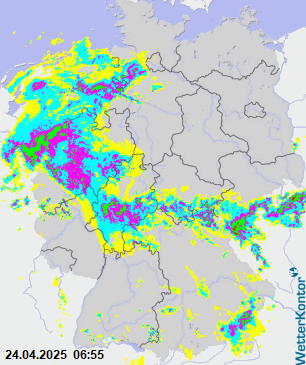Aktuelles Wetter in Deutschland
Die Karte zeigt die aktuellen Messwerte an deutschen Wetterstationen. Durch Klick auf die Button kann man sich die verschiedenen Wetterparameter wie Temperatur, Druck oder Sonnenscheindauer anzeigen lassen. Die Werte werden stündlich erneuert.
Sonnenscheindauer (stündlich) in Minuten
Dienstag, 06.05.2025 um 14:00 Uhr
Bei der Beurteilung von Solarinvestitionen in Deutschland wird ein wesentlicher Erfolgsfaktor oft unterschätzt: der direkte Einfluss von Wetterbedingungen und Sonneneinstrahlung auf die finanzielle Performance. Während viele Anleger primär auf Anlagentechnik, Fördermodelle und Finanzierungskosten achten, bilden meteorologische Faktoren das eigentliche Fundament der Rentabilität.
Besonders bei einem langfristigen Photovoltaik-Direktinvestment können diese Faktoren zu Renditeunterschieden von bis zu 20% führen und sind damit entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg.
Die verfügbare Sonnenstrahlung variiert innerhalb Deutschlands erheblich. Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Zeitraum 1991-2020 zeigen ein deutliches Nord-Süd-Gefälle: Süddeutschland (Baden-Württemberg, Bayern) erreicht über 1150 kWh/m² jährliche Globalstrahlung, während Mitteldeutschland etwa 1050 kWh/m² und Norddeutschland (Schleswig-Holstein, Hamburg) unter 1000 kWh/m² jährlich verzeichnen. Diese Unterschiede von bis zu 20% zwischen Nord und Süd übertragen sich direkt auf den Energieertrag und damit auf die finanzielle Performance von PV-Anlagen.
Die Sonneneinstrahlung auf die geneigte Modulfläche ist der eigentlich relevante Wert. Durch optimale Ausrichtung (typischerweise Südausrichtung mit etwa 25° Neigung) lässt sich circa 15% mehr Einstrahlung nutzen als horizontal. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren sowie von Wirkungsgraden und Verlusten (Performance Ratio von etwa 80-85%) ergeben sich folgende typische spezifische Erträge: In Süddeutschland 1100-1120 kWh pro kWp und Jahr, in Mitteldeutschland etwa 1050 kWh pro kWp und Jahr, und in Norddeutschland 950-1000 kWh pro kWp und Jahr. Für einen Investor bedeutet dies: Bei identischen Investitionskosten und Vergütungssätzen wird eine 30-MW-Anlage in Bayern etwa 10-15% mehr Jahresertrag liefern als im hohen Norden.
Die regionalen Strahlungsunterschiede wirken sich unmittelbar auf die erzielbare Rendite aus. Im Durchschnitt verschieben sich die typischen Renditeerwartungen mit dem Standort:
Südlich gelegene Projekte erreichen etwa 7% jährliche Rendite (6-8%), in Mitteldeutschland sind etwa 6% jährliche Rendite (5-7%) typisch, während norddeutsche Anlagen etwa 5% jährliche Rendite (4-6%) erwirtschaften. Bei einem typischen 30-MW-Großprojekt, bei dem Teilinvestments ab 200.000 Euro angeboten werden, können diese Unterschiede über die gesamte Betriebsdauer (20-30 Jahre) mehrere hunderttausend Euro pro Investor ausmachen.
Neben dem Standort spielen jährliche Wettervariationen eine große Rolle. Langzeitdaten zeigen, dass der Jahresertrag einer PV-Anlage in Deutschland typischerweise um etwa ±10-15% um den Mittelwert schwanken kann. Beispielsweise war das Jahr 2022 mit durchschnittlich etwa 1037 kWh/kWp rund 16% ertragreicher als das trübere Jahr 2024 mit etwa 881 kWh/kWp.
Für Investoren bedeutet dies eine signifikante Schwankung der jährlichen Cashflows. Bei einem typischen 250-kWp-Investment mit einer Vergütung von 5 Cent/kWh kann ein besonders sonniges Jahr Einnahmen von rund 13.000 Euro generieren, während ein durchschnittliches Jahr etwa 11.300 Euro bringt. In einem sonnenarmen Jahr können die Einnahmen auf nur 9.600 Euro sinken – eine Differenz von über 3.400 Euro zwischen dem besten und schlechtesten Szenario.
Diese Variabilität muss in der Finanzplanung berücksichtigt werden, insbesondere wenn ein hoher Fremdkapitalanteil die Investition belastet und feste Zinszahlungen zu leisten sind. Langfristig ausgerichtete Investoren sollten daher ausreichende Reserven einplanen, um auch mehrere schwächere Jahre in Folge überbrücken zu können, ohne in Liquiditätsengpässe zu geraten.
Eine interessante Entwicklung ist der leichte Aufwärtstrend der Sonneneinstrahlung in Deutschland. Die durchschnittliche Globalstrahlung stieg von etwa 1055 kWh/m² (1981-2010) auf 1102 kWh/m² (2001-2020), mit einer Zunahme von rund 0,3% pro Jahr. Dieser langfristige Trend könnte für Investoren positiv sein, sollte aber aus Vorsichtsgründen nicht in konservative Finanzmodelle eingepreist werden.
Die Ausrichtung der Module hat erheblichen Einfluss auf den Energieertrag und sollte bei der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten genau betrachtet werden. Die klassische Südausrichtung maximiert den Gesamtertrag mit starker Mittagsspitze und liefert in der Regel die höchsten absoluten Kilowattstunden pro Jahr. Im Gegensatz dazu bietet die zunehmend populäre Ost-West-Ausrichtung eine flachere Erzeugungskurve mit besserer Morgen- und Abendproduktion, was oft zu einer besseren Netzverträglichkeit führt.
Besonders bemerkenswert ist, dass die Ost-West-Ausrichtung bei Großanlagen trotz eines leicht geringeren Gesamtertrags (typischerweise 5-10% weniger als bei Südausrichtung) häufig bessere wirtschaftliche Ergebnisse erzielen kann. Der Grund liegt in der zeitlichen Verteilung der Stromerzeugung: Während südausgerichtete Anlagen ihre Hauptproduktion in den Mittagsstunden haben, wenn häufig ein Überangebot an Solarstrom und entsprechend niedrige Preise herrschen, produzieren Ost-West-Anlagen mehr Strom in den wertvolleren Morgen- und Abendstunden. Dadurch können sie von höheren Strompreisen zu Zeiten größerer Nachfrage profitieren und teilweise den geringeren Gesamtertrag durch bessere Vermarktungsmöglichkeiten kompensieren.
Die großräumigen Einstrahlungskarten vermitteln einen guten ersten Eindruck, doch für eine präzise Ertragsprognose müssen auch lokale Mikroklimafaktoren berücksichtigt werden. In Flusstälern können lokale Nebelgebiete die Einstrahlung besonders in den Morgen- und Herbstmonaten reduzieren. Industriegebiete mit erhöhter Luftverschmutzung leiden unter verminderter Direktstrahlung, was die Leistung beeinträchtigen kann. Im Gegensatz dazu bieten Standorte in größerer Höhenlage Vorteile durch höhere UV-Strahlungsintensität und bessere Modulkühlung, was den Wirkungsgrad steigert. Auch lokale Windsysteme spielen eine Rolle, da sie die Modultemperatur und damit den Wirkungsgrad beeinflussen können.
Diese lokalen Faktoren können dazu führen, dass der Ertrag benachbarter Standorte um 5-10% variiert, selbst wenn sie in derselben Klimaregion liegen. Eine detaillierte meteorologische Standortanalyse vor der Investitionsentscheidung ist daher unerlässlich, um Überraschungen zu vermeiden und realistische Ertragsprognosen zu erstellen. Professionelle Standortgutachten berücksichtigen idealerweise mehrjährige Strahlungsdaten und lokale Besonderheiten, um die tatsächlich zu erwartenden Erträge präzise abzuschätzen.
Neben der Strahlungsvariabilität bestehen weitere wetterbedingte Risiken für PV-Anlagen:
- Hagelrisiko: Besonders in Süddeutschland häufiger, kann zu Modulbruch führen
- Schneelastrisiko: In alpinen Regionen relevant, erfordert stabilere Unterkonstruktion
- Sturmrisiko: In Küstenregionen und exponierten Lagen höher
Diese Risiken werden durch geeignete Versicherungen (Allgefahren-Versicherung für PV-Anlagen) abgesichert, deren Prämien typischerweise 0,2-0,5% der Anlagensumme pro Jahr betragen. Wetterextreme haben in der Vergangenheit bereits PV-Parks in Deutschland beschädigt, wodurch die Bedeutung eines umfassenden Versicherungsschutzes unterstrichen wird.
Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die natürliche Leistungsabnahme der Module. PV-Module verlieren mit der Zeit langsam an Leistung – im Durchschnitt etwa 0,5% pro Jahr. Über 25 Jahre kumuliert sich dies zu etwa 12% geringerer Leistung. Diese Degradation wird in Wirtschaftlichkeitsberechnungen einkalkuliert und durch Herstellergarantien teilweise abgesichert.
Die zentrale Frage für Investoren ist oft, ob ein teures Projekt in einer sonnenreichen Region besser ist als ein günstiges in einer strahlungsärmeren. Die Antwort liegt im komplexen Zusammenspiel verschiedener Wirtschaftlichkeitsparameter. Bei identischen spezifischen Investitionskosten (Euro pro Kilowatt-Peak) bietet ein sonnenreicher Standort eindeutige Vorteile und höhere Renditen. Wenn jedoch die Investitionskosten in strahlungsärmeren Regionen deutlich niedriger liegen, kann die Rendite dort trotz geringerer Erträge attraktiv sein.
Eine Beispielrechnung verdeutlicht diesen Zusammenhang: Ein Projekt in Süddeutschland mit 1100 kWh/kWp Ertrag und 850 Euro/kWp Investitionskosten kann eine ähnliche Rendite erzielen wie ein norddeutsches Projekt mit 950 kWh/kWp, aber nur 730 Euro/kWp Investitionskosten. Der günstigere Einstiegspreis kompensiert hier den geringeren Ertrag. Viele Investoren fokussieren sich zu stark auf die Einstrahlungswerte und übersehen dabei die ebenso wichtigen Kostenaspekte. Für eine fundierte Entscheidung sollten stets beide Faktoren im Zusammenhang betrachtet werden.
Eine Strategie zur Risikominimierung ist die regionale Diversifikation – die Verteilung von Investments auf verschiedene Standorte in Deutschland. Dies reduziert die Abhängigkeit von lokalen Wetterereignissen und gleicht Strahlungsschwankungen teilweise aus.
Für ein konkretes Investitionsbeispiel betrachten wir ein typisches PV-Direktinvestment mit folgenden Parametern:
- Investitionssumme: 200.000 Euro für 252 kWp
- Spezifische Investitionskosten: 800 €/kWp
- Betriebskosten: 1,5% der Investition pro Jahr
- Stromvermarktungspreis: 5,5 Cent/kWh (vereinfacht)
- Betriebsdauer: 25 Jahre
Bei diesen Annahmen variiert die Rentabilität je nach Standort erheblich:
- Jährlicher Stromertrag: 277.200 kWh
- Jährliche Einnahmen: ca. 15.250 Euro
- Rendite: ca. 7,0% p.a.
- Amortisationszeit: ca. 11 Jahre
- Jährlicher Stromertrag: 239.400 kWh
- Jährliche Einnahmen: ca. 13.170 Euro
- Rendite: ca. 5,0% p.a.
- Amortisationszeit: ca. 14 Jahre
Dieses vereinfachte Beispiel verdeutlicht: Allein der Standortfaktor kann einen Renditeunterschied von zwei Prozentpunkten ausmachen – bei ansonsten identischen Parametern.
Die Bedeutung von Wetter- und Einstrahlungsdaten für die Rendite von Photovoltaik-Direktinvestments kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Regionale Unterschiede von bis zu 20% zwischen Nord- und Süddeutschland beeinflussen die Rentabilität maßgeblich und können bei Großprojekten zu erheblichen absoluten Differenzen in den Erträgen führen. Gleichzeitig erfordern die jährlichen Schwankungen von ±10-15% durchdachte finanzielle Puffer in der Investitionsplanung, um auch schwächere Perioden zu überbrücken.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen auch lokale Mikroklimafaktoren und standortspezifische Wetterrisiken, die sorgfältig analysiert werden sollten, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird. Letztendlich wird die Gesamtwirtschaftlichkeit durch das komplexe Zusammenspiel von Einstrahlungswerten, Investitionskosten und Betriebsparametern bestimmt – ein hoher Ertrag allein garantiert noch keine überdurchschnittliche Rendite.
Für Investoren bedeutet dies: Eine fundierte meteorologische Standortanalyse ist unerlässlich für eine realistische Renditeprognose. Gleichzeitig relativieren optimierte Anlagenkonfigurationen und standortangepasste Vermarktungskonzepte den Einstrahlungsnachteil strahlungsärmerer Regionen teilweise.